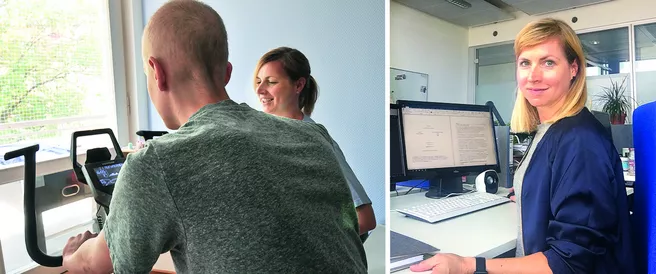Sport als ergänzende Therapieform
Seit einigen Jahren wird Sport bei erwachsenen Krebspatient_innen behandlungsbegleitend eingesetzt. Studien berichten über verbesserte Überlebenschancen und ein geringeres Wiederauftreten von Brust-, Prostata- oder Darmkrebs bei körperlich aktiven Patient_innen. Zudem können die körperliche Leistungsfähigkeit verbessert, die Lebensqualität erhöht und Nebenwirkungen, wie beispielsweise Fatigue (chronische Erschöpfung), verringert werden.
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen
„Die Patient_innen haben sehr gut beim Training mitgemacht und unsere Erwartungen sogar übertroffen“, betont Dr. Sabine Kesting vom Lehrstuhl für Präventive Pädiatrie. „Leider ist die Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen während der Behandlung aber nicht fit genug, um ohne Risiko am HIIT teilzunehmen.“ Damit unterscheiden sich die kleinen Patient_innen deutlich von den Erwachsenen, was die Möglichkeiten therapiebegleitender sportlicher Aktivität angeht. Im Rahmen weiterer Studien müssen daher Intensität und Dosierung dieser spezifischen Trainingsart optimiert werden, so die Sportwissenschaftlerin.
Analyse der physiologischen Mechanismen beim Sporttreiben rücken in den Fokus
Peter Weeber, Doktorand der Professur für Sportbiologie, sieht weitere Unterschiede: „Während wir die physiologische Wirkungsweise von Sport bei erwachsenen Krebspatient_innen schon ganz gut verstehen, ist der Körper krebskranker Kinder hier eher eine Blackbox.“ Sein Fokus liege daher auf der Analyse der physiologischen Wirkungsweise von Sport explizit bei Kindern mit Krebserkrankung. „Wenn wir herausfinden, welche Marker sich bei Kindern durch Sport verändern und wie sich diese auf Krebszellen auswirken, können wir Sport auch in der Kinderonkologie sehr zielgerichtet einsetzen“, so Weeber. Bereits jetzt sind niedrigschwellige Bewegungsangebote unter sportwissenschaftlicher Anleitung für alle krebskranken Kinder in der Kinderklinik München Schwabing der TUM zugänglich.
PD Dr. Irene Teichert-von Lüttichau, Leitung der Abteilung pädiatrische Hämatom-/Onkologie und Stammzelltransplantation in der Kinderklinik München Schwabing und Studienleiterin, ordnet ein: „Sport und Bewegung können die Behandlung krebskranker Menschen unterstützen. Wir möchten daher einerseits Bewegungsangebote für krebskranke Kinder in der Breite etablieren und andererseits verstehen, wie sich körperliche Aktivität im Körper dieser Kinder auswirkt. Dieser translationale Forschungsansatz wird bei uns durch Frau Dr. Kesting und Herrn Weeber implementiert.“
„Die durchschnittlich 2.200 Kinder und Jugendlichen, die jährlich in Deutschland an Krebs erkranken, haben die beste Behandlung verdient. Diese Studie hat gezeigt, dass wir weitere Forschung zum therapiebegleitenden Sport bei Kindern brauchen“, kommentiert Prof. Dr. Renate Oberhoffer-Fritz, Dekanin der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften und Ordinaria des Lehrstuhls für Präventive Pädiatrie.
Die Studie, die an der Kinderklinik München Schwabing der TUM in Kooperation mit der Professur für Sportbiologie durchgeführt wurde, ist nun in der Fachzeitschrift Cancers (Impact Factor: 6.639) publiziert.
Zur Publikation im Journal "Cancers"
Zur Homepage des Lehrstuhls für Präventive Pädiatrie
Zur Homepage der Professur für Sportbiologie
Zur Homepage der Kinderklinik München Schwabing
Kontakt:
Prof. Dr. Renate Oberhoffer-Fritz
Dekanin Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften
Lehrstuhl für Präventive Pädiatrie
Georg-Brauchle-Ring 60/62
80992 München
Tel.: 089 289 24570
E-Mail: renate.oberhoffer(at)tum.de
PD Dr. Irene Teichert-von Lüttichau
Kinderklinik München Schwabing
Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin
Klinikum Schwabing, München Klinik gGmbH und Klinikum Rechts der Isar (AöR) der TUM
Kölner Platz 1
80804 München
Tel.: 089 3068 3076 (Sekretariat)
E-Mail: Irene.Teichert-vonLuettichau(at)mri.tum.de
Dr. Sabine Kesting
Lehrstuhl für Präventive Pädiatrie
Georg-Brauchle-Ring 60/62
80992 München
und Kinderklinik München Schwabing
Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin
Klinikum Schwabing, München Klinik gGmbH und Klinikum Rechts der Isar (AöR) der TUM
Tel.: 089 289 24579
E-Mail: sabine.kesting(at)tum.de
Peter Weeber
Professur für Sportbiologie
Georg-Brauchle-Ring 60/62
80992 München
Tel.: 089 289 24400
E-Mail: peter.weeber(at)tum.de
Text: Gianna Banke
Fotos: Deutsche Herzstiftung e. V./privat